Geldwäscheprävention ist längst kein Randthema mehr. Sie entscheidet über die Stabilität von Finanzsystemen, über die Reputation von Unternehmen – und letztlich über die „license to operate“. Banken, Versicherer, Kryptodienstleister und zunehmend auch Unternehmen aus dem Nicht-Finanzsektor stehen unter wachsendem Druck, ihre Systeme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität laufend zu verbessern. Im Folgenden werden acht häufig gestellte Fragen aufgegriffen und mit Blick auf aktuelle regulatorische Entwicklungen, nationale Besonderheiten und internationale Standards beantwortet.
1. Was ist Geldwäsche und wie unterscheidet sie sich von Terrorismusfinanzierung?
Unter Geldwäsche versteht man den Prozess, bei dem illegal erworbene Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden, um deren Herkunft zu verschleiern und einen Anschein legaler Transaktionen zu erwecken. Dieser Vorgang gliedert sich typischerweise in drei Phasen: Einspeisung (Placement), Verschleierung (Layering) und Integration. In Deutschland ist Geldwäsche nach § 261 StGB strafbar. Seit der Reform des Gesetzes gilt der sogenannte All-Crime-Ansatz, wodurch grundsätzlich jede rechtswidrige Tat als Vortat der Geldwäsche in Betracht kommt.
Die Terrorismusfinanzierung unterscheidet sich insofern, als dass die Gelder nicht zwingend aus illegalen Quellen stammen müssen. Auch rechtmäßig erworbene Mittel können missbraucht werden, um terroristische Aktivitäten zu finanzieren. Entscheidend ist hier also nicht die Herkunft, sondern der Zweck der finanziellen Mittel.
2. Welche Akteure sind auf nationaler und internationaler Ebene relevant?
International ist die Financial Action Task Force (FATF) das zentrale Gremium. Sie entwickelt Standards, überprüft deren Umsetzung in den Mitgliedsstaaten und setzt so globale Leitplanken für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung.
Auf europäischer Ebene spielen Kommission, Rat und Parlament eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung und Weiterentwicklung von Geldwäscherichtlinien. Ergänzt wird dies durch die European Banking Authority (EBA), die eine kohärente Regulierung im Bankensektor sicherstellen soll. Seit 2023 wird die europäische Geldwäschebehörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) aufgebaut. Sie wird ihren Sitz in Frankfurt am Main haben und ab 2026 die direkte Aufsicht über die risikoreichsten Finanzinstitute in der EU übernehmen sowie die Koordination zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden weiter verbessern.
In Deutschland sind insbesondere die Financial Intelligence Unit (FIU) und die BaFin maßgeblich. Während die FIU Verdachtsmeldungen entgegennimmt und auswertet, beaufsichtigt die BaFin Banken, Versicherer und Wertpapierhandel. Ergänzend bestehen auf Ebene der Bundesländer Aufsichtsstrukturen für den Nicht-Finanzsektor. Parallel wird das Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) aufgebaut, um die Zuständigkeiten und Kompetenzen im Kampf gegen Finanzkriminalität in Deutschland zu bündeln. Zudem existiert mit der AFCA (Anti-Financial Crime Alliance) eine öffentlich-private Partnerschaft, die den vertrauensvollen Informationsaustausch zwischen Aufsicht und Finanzbranche fördert.
3. Welche rechtlichen Entwicklungen prägen die Geldwäscheprävention?
Die letzten Jahre waren von einer erheblichen Verdichtung regulatorischer Vorgaben geprägt. Die EU hat mit der 4. und 5. Geldwäscherichtlinie wichtige Grundlagen geschaffen. Während die 4. Richtlinie den risikobasierten Ansatz stärkte, erweiterte die 5. Richtlinie den Kreis der Verpflichteten – etwa auf Kryptodienstleister – und legte den Fokus auf Transparenz und Terrorismusfinanzierung. Eine wirkliche Harmonisierung und weitere Verschärfung ist mit der kommenden 6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) und dem EU-AML-Paket geplant, dessen finale Umsetzung derzeit noch aussteht.
Die bisherigen Gesetzesänderungen in Deutschland, wie etwa die Neufassung des § 261 StGB und die Implementierung des All-Crime-Ansatzes, erfolgten auf Grundlage der bisherigen Richtlinien und eigenständiger nationaler Reformen. National kam mit dem Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG Gw) 2021 eine weitere Verschärfung hinzu. Seitdem müssen alle Rechtseinheiten ihre wirtschaftlich Berechtigten aktiv melden – eine bloße Mitteilungsfiktion reicht nicht mehr aus. Weitere Gesetzesinitiativen wie das geplante Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz sollen die Schlagkraft der FIU erhöhen, ein Immobilientransaktionsregister einführen und moderne Technologien stärker in den Kampf gegen Finanzkriminalität einbeziehen. Parallel sorgt die MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) für ein engmaschigeres Regime im Kryptobereich.
4. Welche drei Säulen tragen die Geldwäscheprävention in Unternehmen?
Die gängige Struktur basiert auf drei Säulen: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten (KYC) und Verdachtsmeldungen.
- Risikomanagement umfasst die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, die Implementierung interner
Sicherungsmaßnahmen und eine systematische Risikoanalyse. - KYC verpflichtet Unternehmen, Kunden zu identifizieren, deren Identität zu überprüfen, wirtschaftlich
Berechtigte festzustellen, den PEP-Status zu prüfen und Geschäftsbeziehungen kontinuierlich zu überwachen. - Verdachtsmeldungen müssen an die FIU abgegeben werden, sobald Hinweise auf illegale Mittel oder
Terrorismusfinanzierung bestehen.
Diese Säulen sind Kernbestandteil jeder wirksamen AML-Strategie und sichern Integrität, Funktionsfähigkeit und Reputation.
5. Welche Rolle übernimmt der Geldwäschebeauftragte?
Der Geldwäschebeauftragte ist zentrale Schlüsselfigur im System der Prävention. Seine Bestellung muss der BaFin angezeigt werden, er berichtet unmittelbar an die Geschäftsleitung und genießt besonderen Kündigungsschutz. Seine Aufgaben sind vielfältig: von der Risikoanalyse über die Entwicklung interner Richtlinien bis hin zur Bearbeitung von Verdachtsfällen und deren Meldung an die FIU. Zudem ist er für Schulungen verantwortlich und erstattet jährlich Bericht an die Geschäftsleitung. Mit umfassenden Einsichts- und Auskunftsrechten ausgestattet, trägt er maßgeblich zur Wirksamkeit der Compliance-Strukturen bei.
6. Was bedeutet „Know Your Customer“ konkret?
KYC ist der operative Kern der Geldwäscheprävention. Es umfasst die Identifizierung und Verifizierung von Kunden, die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten und die Abklärung des PEP-Status. Ebenso wichtig ist die Risikoklassifizierung von Kunden sowie die kontinuierliche Überwachung von Geschäftsbeziehungen. Werden die Anforderungen nicht erfüllt, bleibt nur die Beendigung oder Nichtaufnahme der Geschäftsbeziehung.
7. Welche Rolle spielen Finanzsanktionen?
Finanzsanktionen unterscheiden sich grundlegend von klassischen Geldwäschehandlungen. Während es bei Geldwäsche darum geht, illegale Mittel zu verschleiern, verbieten Sanktionen bestimmte Transaktionen unabhängig von der Herkunft der Gelder. Verstöße können zu erheblichen Bußgeldern, Reputationsschäden und sogar Haftstrafen führen. Für Unternehmen bedeutet das: Sie benötigen robuste Systeme zum Sanktionsscreening und ein konsequentes Compliance-Management.
8. Welche Bedeutung haben interne und externe Prüfungen?
Sowohl interne als auch externe Prüfungen sind unverzichtbar. Extern erfolgen sie durch Jahresabschlussprüfungen oder Sonderprüfungen der BaFin. Intern prüft die Revision nach MaRisk alle wesentlichen Prozesse in regelmäßigen Abständen. Beide Prüfungsarten sind entscheidend, um Schwachstellen aufzudecken, die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sicherzustellen und die Compliance-Kultur im Unternehmen zu stärken.
Fazit
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention wachsen kontinuierlich. Unternehmen sind gefordert, ihre Systeme nicht nur regelkonform, sondern auch zukunftsfähig aufzustellen. Der richtige Mix aus Risikomanagement, KYC, Meldesystemen, Sanktionskontrolle und unabhängiger Prüfung entscheidet darüber, ob Organisationen regulatorischen Anforderungen gerecht werden – und ob sie das Vertrauen sichern von Kunden, Geschäftspartnern und Aufsicht.
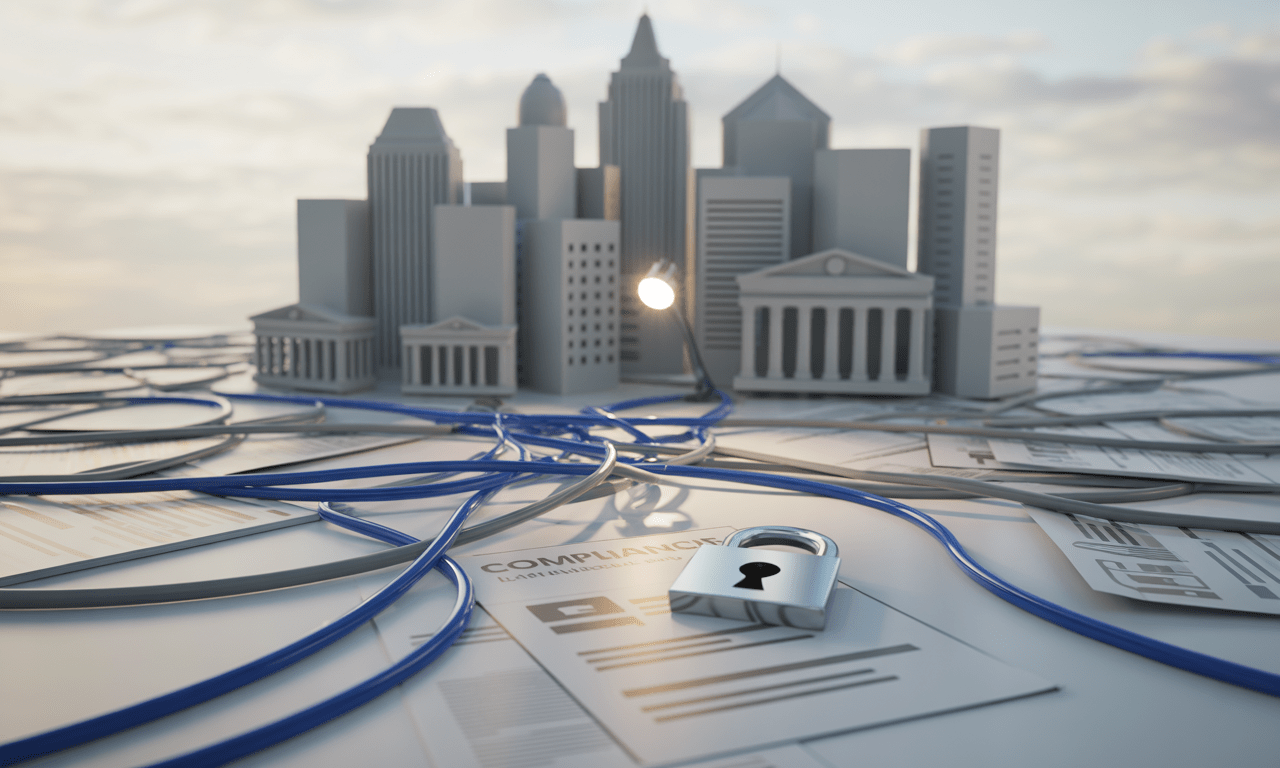
Hinterlasse einen Kommentar